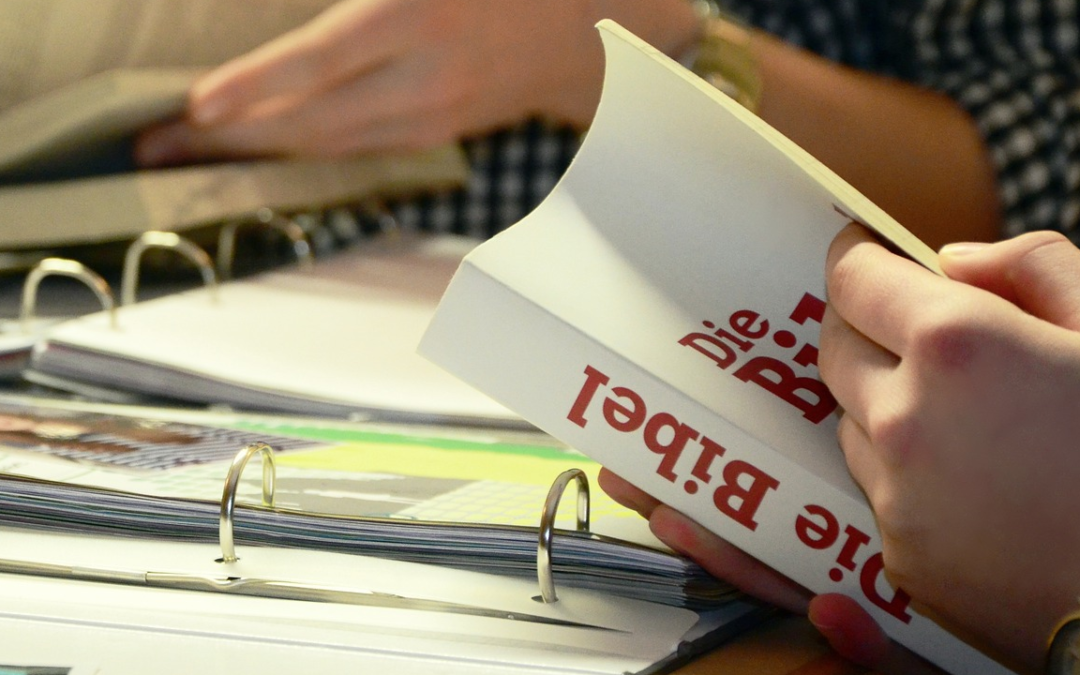Der Religionsunterricht hat je nach Kanton sehr unterschiedliche Entwicklungen hinter sich. Christian Höger, Leiter des Religionspädagogischen Instituts Luzern (RPI), erklärt im Interview, was heute einen guten Religionsunterricht ausmacht.
Stephan Leimgruber
Christian Höger, wie haben Sie Ihren Religionsunterricht erlebt?
Als Schüler habe ich von der Grundschule bis zum Abitur jede Woche zwei Stunden katholischen Religionsunterricht genossen. Tatsächlich ist mir nicht mehr allzu viel in Erinnerung geblieben: Ein Negativbeispiel aus der 5. Klasse am Gymnasium bei einem Pfarrer war das Auswendig-lernen-Müssen eines moralinsauren Satzes, den ich mir bis heute gemerkt habe: «Wenn dein Platz in der Kirche leer bleibt, dann schliesst du dich aus der Gemeinschaft aus, welche das Gottesvolk Sonntag für Sonntag am Altar bildet!» Ein Lichtblick waren dagegen die vielen Diskussionen in der Oberstufe, bei denen wir unsere unterschiedlichen Meinungen sagen durften und von unserem engagierten Religionslehrer aus der Reserve gelockt wurden.
Trotz dieser Erfahrungen haben Sie Theologie studiert.
Meine Motivation für das spätere Theologiestudium speiste sich damals weniger aus dem erlebten Unterricht, sondern vor allem aus meinen positiven Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit. Mein Berufsziel war dabei noch gar nicht Religionslehrer, geschweige denn Religionspädagogikprofessor, sondern Pastoralassistent.
Was zeichnet einen guten Religionsunterricht aus?
Ein guter Religionsunterricht lebt davon, die Schülerinnen und Schüler für die Beschäftigung mit religiösen Themen zu interessieren und an ihren Erfahrungen und Fragen anzuknüpfen. Am Ende sollen sie kompetent über Religionen und das Christentum sowie ihre eigene Konfession Bescheid wissen und sich mündig dafür oder dagegen entscheiden können. Natürlich ist hierbei das ganze Themenspektrum von A wie Adam und Eva bis Z wie Zukunft auszuschöpfen, wie es dem jeweiligen Lehr- bzw. Bildungsplan entspricht. Methodisch sind der Fantasie der Lehrkräfte keine Grenzen gesetzt und ich plädiere für eine Variation aus diversen religionsdidaktischen Prinzipien, zum Beispiel ästhetisches, erinnerungsgeleitetes und biblisches Lernen.
Wie wichtig sind dabei heute das Digitale und Mediale?
Sie gehören in einen guten Unterricht, aber immer mit Augenmass und ausgerichtet auf die entsprechenden Kompetenzen. Digitalisierung alleine bringt noch keinen religionspädagogischen Mehrwert. Am wichtigsten ist mir für einen guten Unterricht die Beziehungsebene: Die Schülerinnen und Schüler wollen von der Lehrperson gehört und wahrgenommen sowie mit ihren Ein- und Vorstellungen gewürdigt werden. Es geht um echte Subjektorientierung. Dann kann mit theologisch und religionspädagogisch versierten Pädagoginnen und Pädagogen ein sehr gewinnbringender Unterricht in allen Alters- und Schulstufen gelingen.
In der deutschsprachigen Schweiz vollzieht man seit einigen Jahren die Unterscheidung von schulischem Religionsunterricht und gemeindlicher Katechese. Das Unterrichtsfach heisst nun Ethik und Religionen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
An sich empfinde ich diese Entwicklung, die ja in jedem Kanton der Deutschschweiz ein klein wenig anders und nicht geradlinig verläuft, als interessant und chancenreich. Die religionskundliche Thematisierung von Religionen im Unterricht der Primarstufe und Sekundarstufe I bzw. in Religionslehre oder Ethik und Religionen in den oberen Jahrgängen der Kantonsschule bietet im Idealfall durchaus eine gute Orientierung und Wissensvermittlung über vielfältige religiöse Phänomene. Auch ich selbst verantworte an der Theologischen Fakultät der Uni Luzern den Studiengang Master Religionslehre mit Lehrdiplom für die Sekundarstufe II des Gymnasiums.
Was ist Ihnen dabei wichtig?
Wichtig ist mir beim staatlich verantworteten obligatorischen Religionsunterricht, dass existenzielle Fragen der Heranwachsenden nicht ausgespart werden, was passieren könnte, wenn eine bestimmte religionswissenschaftliche Richtung die Oberhand gewinnen sollte, die bei einem reinen Informieren stehenbliebe. Beim Fach Ethik und Religionen könnte ein weiteres Problem womöglich darin liegen, wenn die ethischen und gemeinschaftskundlichen Themen den Religionen zu viel Platz wegnähmen. Insgesamt gesehen halte ich die Schweizer Lösung auf ihrem rechtlichen und historischen Boden doch für eine chancenreiche Option, auch wenn ich selbst den Grossteil meines Lebens den Religionsunterricht in einer anderen konfessionellen Konzeption an staatlichen Schulen kennengelernt habe. Besonders chancenreich ist das Schweizer Gesamtmodell dann, wenn es neben der ersten Säule des religionskundlichen obligatorischen Religionsunterrichts noch Platz für Katechese in der Gemeinde, die zweite Säule, und konfessionellen, zum Beispiel katholischen oder ökumenischen Religionsunterricht als freiwilliges Zusatzangebot im Idealfall auch unter dem Dach der Schule gibt – die dritte Säule.
Wird der Religionsunterricht nun ein quasineutrales Fach?
Der obligatorische religionskundliche Unterricht ist anders als der konfessionelle Unterricht, der freiwillig besucht werden kann, ein Fach, das nicht zu einem bestimmten Glaubensbekenntnis einladen will. Insofern ist seine Neutralität konsequent und richtig. Natürlich kann man immer den Vorwurf an religionskundliche Konzepte hören bzw. lesen, dass hier eine Neutralität vorgegaukelt werde, die es nie geben könne, da jede Lehrkraft irgendeinen normativen Standpunkt vertrete. Doch dieser Vorwurf greift meines Erachtens zu kurz. Jede Lehrperson hat – unabhängig vom Setting – in religiösen Dingen immer einen eigenen Standpunkt und der darf in geregeltem Masse auch in den Unterricht einfliessen.